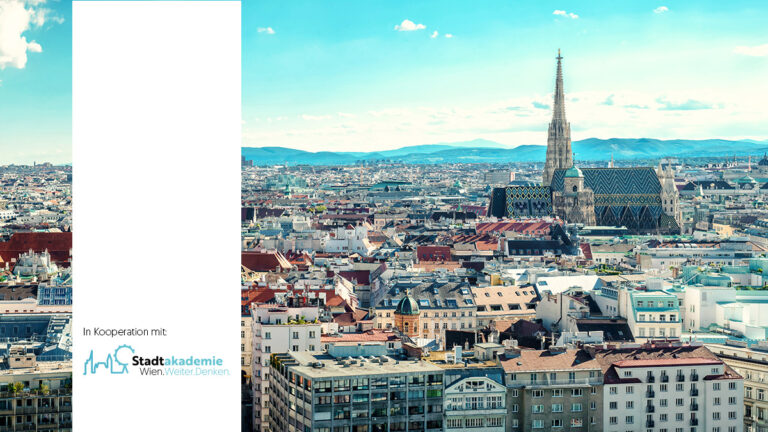Am 27. Jänner 2025 jährt sich die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Erinnerung lebendig zu halten. Daher nahm der Campus Tivoli unter Präsident Wolfgang Sobotka diesen Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus zum Anlass, gemeinsam mit dem ÖVP Parlamentsklub und dem Wilfried Martens Centre for European Studies eine Gedenkveranstaltung auszurichten. Unter dem Titel „Gedenken. Erinnern. Vermitteln.“ hat eine hochrangig besetzte Diskussionsveranstaltung in den Räumlichkeiten des Österreichischen Parlaments stattgefunden. Sobotka erörterte, warum es heute wichtiger denn je sei, mit der Geschichte verantwortungsvoll umzugehen: „Wir tragen die Verantwortung, unsere Gedenkkultur für die nächsten Jahrzehnte weiterzuentwickeln und die Erinnerung an den Genozid in unserer Gesellschaft nicht verblassen zu lassen.“
Nationalratsabgeordneter Wolfgang Gerstl begrüßte die Gäste mit den Worten „Herzlich willkommen im Hohen Haus, in dem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu Hause sind.“ In seiner Einführung zollt er jenen Menschen höchsten Respekt, die Widerstand geleistet und das mit ihrem Leben bezahlt haben: „Wir erinnern an jeden einzelnen Menschen, der von den Nazis zuerst stigmatisiert, dann ausgegrenzt, dann entrechtet, dann beraubt, dann verfolgt, dann gequält und schließlich ermordet wurde. Wir gedenken auch der Überlebenden des Holocausts, denn der ging nie aus ihrem Leben und auch nie aus dem Leben ihrer Familien.“
Hannah Lessing ist Vorstand des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Sie plädierte in ihrem Vortrag dafür, dass Erinnern und Gedenken neue Mittel und Ausdrucksformen finden müssten, damit auch künftige Generationen zu erreichen seien: „Die Summe dieser Erinnerungen ist in ihrer Intensität und Unmittelbarkeit unendlich reicher als das in den Geschichtsbüchern vermittelte Wissen. […] Mit dem Sterben der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen stirbt Geschichte vor unseren Augen. Von den rund 30.000 Überlebenden, die sich in den Jahren an den Fonds gewandt haben, gibt es nicht mehr viele, die die Kraft haben, immer wieder von dem, was geschehen ist, zu erzählen. Mit dem Verschwinden der Zeitzeugen geht ein allmähliches Verblassen der Erinnerung einher. Ein Fade-out.“
In einer ersten Diskussionsrunde kamen neben Lessing weiters die Politikwissenschaftlerin Jasmin Freyer, IFES-Studienautor Thomas Stern und Gedenkdiener Paul Brandacher zu Wort, die über die Zukunft der Gedenk- und Vermittlungskultur auch in sozialen Netzwerken diskutierten.
Psychologe und Autor Ahmad Mansour, arabischer Israeli palästinensischer Herkunft, sprach über seine persönliche Betroffenheit vom Nahostkonflikt, denn er ist mit ihm groß geworden. Er hebt hervor, dass ohne Versöhnung und Reflexion in der Region kein Frieden möglich sei: „Ohne Versöhnung, ohne Reflexion und ohne tiefgreifende Veränderung wird im Nahen Osten kein Frieden zurückkehren.“ Er thematisierte in seiner Keynote die Rolle von Antisemitismus in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und nimmt Stellung zum Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, der den größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust darstellt. „Der 7. Oktober hat sichtbar gemacht, was wir in unserer Gesellschaft verdrängen wollten.“ Er betont die Notwendigkeit, gesellschaftliche Herausforderungen offen zu benennen und Lösungen zu finden und appelliert: „Wir müssen alles tun, um ein jüdisches Leben in Europa sicherer und möglich zu machen.“
Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine weitere Diskussionsrunde, in der Moderator Rainer Nowak neben Ahmad Mansour gemeinsam mit Clara Nathusius (Mitbegründerin von Fridays for Israel), Caroline Hungerländer (Abgeordnete zum Wiener Landtag) und Isolde Vogel (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes) das Thema Antisemitismus und Antizionismus nach dem 7. Oktober beleuchtete.
——
Im Vorfeld der Veranstaltung wurde anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus an der Shoah-Namensmauern-Gedenkstätte im Wiener Ostarrichi-Park ein Kranz niedergelegt und den Opfern gedacht.