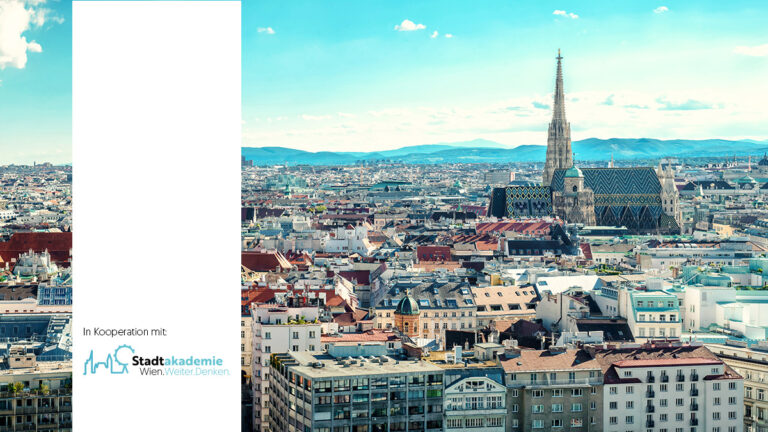Akademie-Präsidentin und Nationalratsabgeordnete Bettina Rausch, betonte in ihrer Einleitung dass es aus ihrer Sicht zu kurz greife, den Begriff Bürgerlich als Konsumbegriff zu sehen. Bürgerlich zu sein bedeutet weit mehr als schöne Erlebnisse, Kunst oder wertige Güter zu konsumieren. Bürgerlich zu sein bedeute vor allem zu gestalten und das sei nicht voraussetzungslos. Dafür brauche es Bildung – und zwar gleichermaßen für Geist und Herz. Aber wie müsse Bildung in dieser schnelllebigen Welt heute aussehen und was brauche es um als mündige Bürgerin, als mündiger Bürger an der Gesellschaft aktiv teilhaben zu können?
Bildung betrifft alle
Moderator Jakob Calice, Geschäftsführer des Österreichischen Akademischen Dienstes, griff diese Fragen auf. Aus seiner Sicht wäre das Thema Bildung deshalb so spannend, weil es alle beträfe. Jeder und jede hätte Erlebnisse mit Bildung im Rahmen der Pflichtschulzeit gehabt, danach würden die meisten noch eine weiterführende Ausbildung absolvieren oder in Weiterbildung investieren. „Wer in die eigene Bildung investiert“, so Calice, „der leistet einen wichtigen Beitrag für eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft.“
Wie aktuell ist das humanistische Bildungsideal heute noch?
Heute sind viel mehr Informationen wesentlich schneller verfügbar, als ein Bücherregal jemals fassen könnte. Das ist bezeichnend für die Veränderungen, die die Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft mit sich bringt. Mit diesem Bild warf Calice die Frage auf, wie aktuell das humanistische Bildungsideal in unserer Welt noch sei. Antonia Gössinger, ehemalige Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten, warf ein, dass dieses Ideal aus ihrer Sicht immer noch aktuell wäre. „Nur, wer vermittelt es? Wer lebt heute noch bürgerliche Werte vor“ warf Gössinger auf.
Bürgerliche Bildung in der Krise?
Der Jugendkulturforscher Prof. Bernhard Heinzlmaier diagnostizierte, dass die Begriffe Bürgerlich und Bildung sich in einer Krise befänden. „Bürgerlichkeit hat sich als Begriff verloren und löst sich immer mehr im Säurebad des Liberalismus auf“, so Heinzlmaier. Bildung gleitet für Heinzlmeier immer mehr in die Einseitigkeit ab: „Es geht immer mehr um die Vermittlung von Kompetenzen. Die Vermittlung eines humanistischen Bildungsideals findet praktisch nicht statt.“ Menschen würden nur mehr als Produktivkräfte gesehen. Wichtig wäre für Heinzlmaier diese Eindimensionalität zur Diskussion zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das humanistische Element neben dem Kompetenzelement gleichberechtigt wäre.
Selbstbildung als Voraussetzung stabiler Gesellschaften
Bei Bildung gehe es für der Jugendkulturforscher auch um Glücks- und Sinnerfahrungen. Diese könne die reine Nutzenebene nicht bieten. Für Heinzlmaier haben Bildungsinstitutionen nach humanistischen Idealen die Aufgabe, Menschen bei ihrer Selbstbildung zu unterstützen. „Wenn wir darauf nicht achten dann kommt es zu einer Verrohung der Gesellschaft, in der jeder nur auf seinen Vorteil bedacht ist.“ Heinzlmaier sieht darin eine Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaft. Er könne natürlich den Wunsch junger Menschen verstehen, sauf Basis ihrer Ausbildung auch selbstständig ihr Leben bestreiten zu können. Nur dürfe man nicht vergessen, dass dazu neben konkreten Kompetenzen auch die Fähigkeit gehöre Orientierungs- und Sinnfragen beantworte zu können.
You get what you meassure
Klemens Riegler-Picker, der lange im Bildungsministerium u.a. als Sektionschef tätig war und aktuell als Co-Geschäftsführer die Bildungsplattform-GmbH der WKÖ leitet, sah in dieser Diskussion eine der großen Herausforderungen des Bildungssystems. Grundsätzlich sprach er sich dafür aus, dass Bildung beiden Ansprüchen, dem humanistischen und dem zweckdienlichen, gerecht werden müsse. „In Österreich“, so Riegler-Picker, „haben wir ein sehr stark ausdifferenziertes Schulsystem. Es gibt einen sehr starken Sog in die berufsbildenden höheren Schulen.“ Das würde wiederum einen gewissen Druck in den Allgemein Höheren Schulen erzeugen, sich ebenfalls verstärkt Richtung Berufsorientierung zu gehen. Internationale Vergleiche wie die PISA-Studie würden dies noch verstärken. Denn diese Messungen würden das Bildungssystem stark auf Richtung „Zweckdienlichkeit“ ausrichten. Letztendlich, so der Bildungsexperte, sei die Frage von Absolventinnen und Absolventen wie sie mit ihrer Ausbildung ein würdiges Leben bestreiten könnten sehr gerechtfertigt. Doch, so Riegler-Picker, die Schule könne diese Frage alleine nicht beantworten. Die Familie würde hier eine ebenso zentrale Rolle spielen, wenn es etwa darum gehe ein Wertegerüst aufzubauen.
Bildung und Digitalisierung: Kompetenzboom oder Kulturverlust?
Was digitale Kompetenzen betrifft sahen alle Expertinnen und Experten junge Menschen gut aufgestellt. Allerdings, so Gössinger, würde diese Kompetenz vor allem im technischen Bereich lieben: „Es reicht nicht nur die Hardware zu beherrschen. Man muss auch die Inhalte beurteilen können“. Bei einer Umfrage unter 1.200 höheren Schülerinnen und Schülern in Kärnten vor zwei Jahren hätten lediglich 11% der befragten angegeben noch klassische Medien wie Zeitung, Radio oder Fernsehen zu konsumieren. Mehrheitlich wurde damals vor allem Youtube genutzt. „Eine Demokratie braucht mündige Mediennutzer“, so Gössinger.
Riegler sah in der Digitalisierung eine gute Ergänzung, die aber keinesfalls die Beziehung zwischen Lernendem und Lehrendem ersetzen könne. Weiters gäbe es in den Schulen viel mehr Autonomie als früher, die aber eben auch genutzt werden müsse. Es gäbe die Möglichkeit Lehrmittel eigener Wahl in den Unterricht zu integrieren und verstärkt projektorientiert zu arbeiten. Gerade bei diesen neuen Arbeitsweisen würde auch Werte in der Kooperation mit anderen vermittelt.
Bildung darf kein Privileg sein
Akademie-Präsidentin Rausch rundete die Diskussion mit ihrer Zusammenfassung ab: Gerade wenn es um Bildung gehe, dann könne ein bürgerlicher Zugang nie exklusiv sein. Vielmehr müsse es darum gehen allen die Voraussetzungen zu geben damit sie ihren persönlichen „persuit of happiness“ auch umsetzen könnten. Dazu gehöre für sie auch ganz besonders, dass es für alle möglich sein müsse an der Gesellschaft teilzuhaben und diese auch mitgestalten zu können.