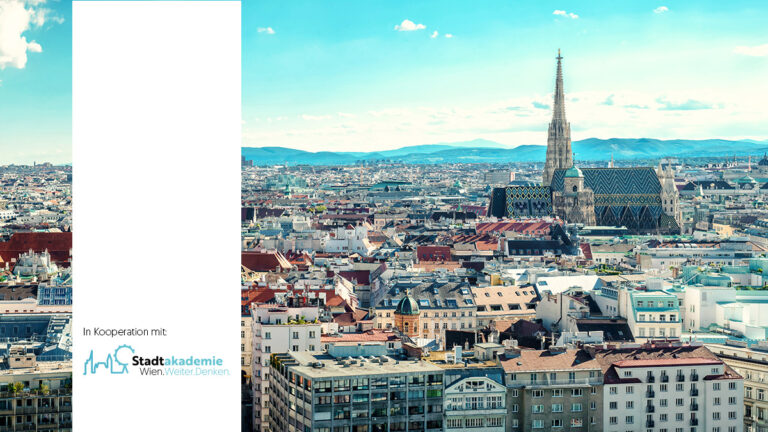Am 25. April präsentierte der Campus Tivoli im Haus der Industrie das Jahrbuch für Politik 2024. Im aktuellen Jahrgangsband werden die Europawahl, die Nationalratswahl, die Landtagswahlen in Vorarlberg und in der Steiermark, die Koalitionsverhandlungen und die Koalitionsbildung auf Bundesebene sowie volkswirtschaftliche Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung behandelt. Für den Präsidenten des Campus Tivoli Wolfgang Sobotka ist das Jahrbuch für Politik keine bloße Rückschau, sondern richtet den Blick auf die Zukunft. Über parteipolitische Grenzen hinweg werde österreichische Zeitgeschichte für die Nachwelt auf hohem Niveau analysiert und dokumentiert. Intention des Jahrbuches sei es, verschiedene Themen in der Tiefe zu recherchieren, zu analysieren und vor allem zu debattieren. Jede demokratische Diskussion lebt von diesem Diskurs, so die Überzeugung Sobotkas.
Praxisorientiert, österreichzentriert, keine politologische Kunstsprache
Chef-Herausgeber Andreas Khol sieht das Jahrbuch als Plattform für verschiedene Autoren aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Beim Themenschwerpunkt Wahlen verwies Khol auf die Fehleinschätzungen der Demoskopen. Da sich die Parteienlandschaft dramatisch verschob, gibt es von Parteienvertretern von Volkspartei, Sozialdemokratie, Freiheitlichen, Grünen und NEOS einen Ausblick auf kommende parteipolitische Strategien. Als weitere Schwerpunktthemen des Jahrbuchs 2024 nannte Khol Bildung, Sicherheit und Landesverteidigung sowie einen kulturpolitischen Beitrag über die Nichtära Martin Kušei im Burgtheater.
Der Wähler als wankelmütiges Wesen
In der ersten Diskussionsrunde wurde die Frage der Wählervolatilität diskutiert. Moderator Michael Fleischhacker, Moderator von Talk im Hangar 7 (Servus TV) fragte, inwieweit der Wähler ein wankelmütiges Wesen sei. Der Meinungsforscher Paul Unterhuber verriet neben soziodemografischen Merkmalen auch aktuelle Stimmungslagen, anhand denen der modernde Wechselwählertypus festgemacht werden könne. Bettina Rausch-Amon, ehemalige Nationalratsabgeordnete der Volkspartei sieht im höheren Wechselwähleranteil auch einen Ansporn für die Politiker. Bei jeder Wahl müssen die Parteien erneut um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler werben, was auf eine funktionierende Demokratie hinweise. Maria Maltschig, Direktorin des Karl-Renner-Instituts, ergänzte diesen Befund: Obgleich die Parteienbindung generell abflache, zeige sich, dass nur rund 10 Prozent zur Gruppe der Wechselwähler gehören. Der sogenannte Wankelmut der Wähler sei ihr legitimes Recht als Souverän. Der Politikberater Thomas Hofer drehte das Argument um: Auch die Parteien stünden vor der Schwierigkeit, von den Wählerinnen und Wählern als zu wankelmütig und unentschlossen wahrgenommen zu werden. Hofer verwies auf den Zick-Zack-Kurs bei der Corona-Politik. Hofer glaubt, dass die politischen Akteure Vertrauen zurückgewinnen können, wenn sie anstelle einer tagespolitischen Fokussierung Leuchtturmprojekte als Narrative anbieten.
Bildungskatastrophe – Medienhype oder Realität?
In der zweiten Diskussionsrunde wurde die aktuelle Situation an Wiener Pflichtschulen diskutiert. Christian Klar, Direktor einer Mittelschule, nannte mangelnde Lernbereitschaft als größtes Problem. Politische Beschlüsse, etwa Deutschkurse im Sommer, bringen nichts, wenn diese beim Fernbleiben nicht sanktioniert werden, so Klar. Der Soziologe Bernhard Heinzlmaier verwies auf die Wichtigkeit der Vermittlung der westlichen Wertvorstellungen bei arabisch migrantischen Schülerinnen und Schülern. Sämtliche Parteien hätten in den vergangenen Jahren das Thema Islam nahezu tabuisiert. Heinzlmaier bemängelte ein naives Weltbild gegenüber kultureller und religiöser Intoleranz in migrantischen Milieus.
In Summe war die Präsentation des politischen Jahrbuches ein multiperspektivischer Überblick auf das politische Jahr 2024. Wer tiefer in das politische Geschehen eintauche möchte, kann das „Österreichische Jahrbuch für Politik“ im Büchershop des Campus Tivoli zum Preis von € 49 beziehen.
Pressesplitter