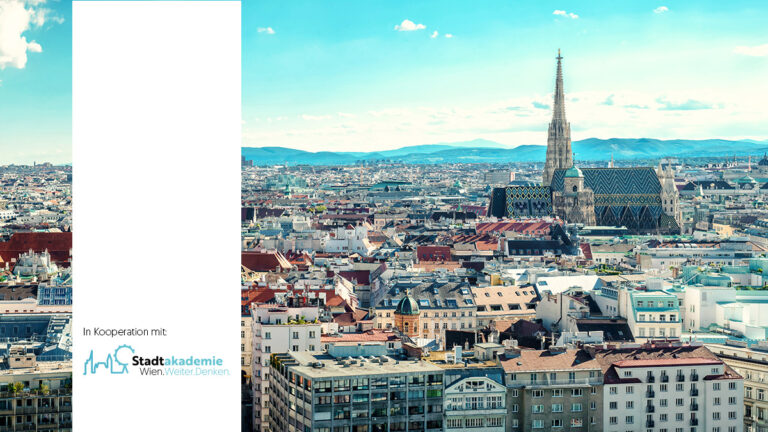Identitätspolitik, Wokeness und Cancel-Culture prägen unsere Diskussionskultur und damit unsere Demokratie. Die Aufteilung unserer Gesellschaft in Opfer- und Schuldigen-Gruppen setzt einen Wettbewerb zwischen Diskriminierungsmerkmalen in Lauf. Wenn die Betroffenheit von bestimmten Diskriminierungsmerkmalen als Voraussetzung für Repräsentation gesehen wird, befinden wir uns im Grenzbereich unserer liberalen Demokratie.
Inwiefern gefährdet Identitätspolitik, auch unter dem Namen „Wokeness“ oder „Cancel-Culture“ bekannt, unsere liberale Demokratie? Welche Rolle spielt Identität für den gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Zusammenhalt? Darüber sprachen namhafte Speakerinnen und Speaker am 31. August bei der Podiumsdiskussion, die die Politische Akademie gemeinsam mit der Julius Raab Stiftung im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach veranstaltet hat.
Einleitend hielt Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie und Nationalratsabgeordnete, fest, dass viele Bewegungen, die „Identitätspolitik“ betreiben, grundsätzlich ihren Ursprung in guten Sachen haben. Es wird aus der Motivation heraus gehandelt, Menschen zu unterstützen, ihnen eine Stimme zu verleihen und sie selbst zu ermächtigen. „Aber wie so oft, schießen diese Bewegungen über ihr ursprüngliches Ziel hinaus und wir erleben eine Situation, in der wir uns fragen, sind unsere Werte, ist unsere liberale Demokratie in Gefahr“, so Rausch zu Beginn der Veranstaltung.
Wie genau es dazu kommt, erläuterte Historikerin und Soziologin Dr. Sandra Kostner, von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd:
„Identitätspolitik teilt die Gesellschaft auf nach Opfer- und Schuldigenmerkmalen“. Diejenigen, die eine Opferidentität zugeschrieben bekommen, die bekommen das Recht, Forderungen an die Schuldgruppe zu stellen nach moralischer, symbolischer oder eben auch materieller Kompensation. Bekannte Beispiele dafür sind Forderungen nach Quoten oder sprachliche Anforderungen, um „Mikroaggressionen“ zu vermeiden. Die Botschaft, dass das System und nicht einer selbst dafür verantwortlich ist, dass man nicht vorankommt, hindert jedoch Mobilitätsprozesse anstatt sie zu fördern. Außerdem mangelt das Konzept der „systemischen Diskriminierung“ einer Evidenzgrundlage, was sich am Beispiel Bildung zeigt: Obwohl Männer das Schulsystem aufgebaut haben und Mädchen lange vom Schulsystem ausgeschlossen waren, sind sie im Schulsystem mittlerweile erfolgreicher als Männer, wenn man sich die Schulabschlüsse anschaut. Notwendig wäre es, die Theorie der Realität anzugleichen und nicht umgekehrt.
An diesem Punkt setzte Universitätsprofessor Christian Stadler, Rechtsphilosoph an der Universität Wien, an. Er erinnerte daran, dass das Bemühen, die Realität der Theorie anzupassen, beim Marxismus blutig endete. „Wenn jede Werteschwankung zur persönlichen Schuld umgedeutet wird, dann ist Liberalität zu Ende, dann ist Freiheit weg“, brachte der Rechtsphilosoph es auf den Punkt. Er zitierte Hegel, der sagte, dass Ideologie bedeute, einen Teil der Wahrheit für die ganze Wahrheit zu erklären.
Weiters berief sich Professor Stadler auf Platon, dessen Ansatz der gemeinsamen Suche nach der einen Wahrheit ein „meine Wahrheit gegen deine Wahrheit“ ausschließt. Dabei sieht Stadler eine klare Identität als Voraussetzung für Toleranz. Wenn ich weiß, wer ich bin, fühle ich mich von anderen Meinungen nicht so leicht angegriffen und kann sie stehen lassen. Dies sei auch eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Leben in Gemeinschaft und sei relevant für die Integrationspolitik. Wir haben bestimmte Standards, die wir erwarten und Werte, die uns wichtig sind. In migrantisch geprägten Gesellschaften werden diese Selbstverständlichkeiten im Zeichen von allgemeiner Gleichheit oft nicht angesprochen. Dabei bringt das Umfeld, in dem man sich ständig neu definieren muss, Unsicherheit und diese wiederum Aggression. Eine klare Identität, die mit Traditionen untermauert wird, hat eine hohe soziale Funktionalität. Stadler betonte, dass es deswegen wichtig sei, Identität von Identitätspolitik zu trennen, sonst wird uns etwas sehr Wesentliches kaputtgemacht. Zum Schluss seines Impulses verwies Stadler auf das Wertebuch der Julius Raab Stiftung, in dem steht „ohne Werte bauen wir unsere Zukunft auf Treibsand“. Wir stehen zwar irgendwie, aber wir haben keinen Halt. „Begreifen wir Identität als notwendige Stabilisierungsdimension“, sagte Stadler abschließend.
Dass wiederum Identitätspolitik die gemeinsame Basis für unsere Demokratie gefährde, erläuterte Dr. Alexander Kissler, Redakteur der Neuen Züricher Zeitung in Berlin. Identitätspolitik sei ein Gruppenphänomen, in dem eine Wettbewerbssituation zwischen verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen kreiert wird. Dabei wird die Betroffenheit von einer bestimmten Form von Diskriminierung als Voraussetzung für eine adäquate Repräsentation wahrgenommen.
„Durch die Identitätspolitik kommen wir in Grenzbereiche des Republikanischen. Denn wenn der Einzelne nicht mehr vom anderen vertretbar ist, dann haben wir auch irgendwann keine Demokratie mehr“, bekräftige Journalist und Autor Alexander Kissler seine Argumentation.
Weiters sei die gemeinsame Sprache wichtig, um sich einander vermittelbar zu machen. Bei Identitäten als Label, die man ständig ändern kann, wird das zunehmend schwierig: „Im Subjektivismus kann nur mehr einer selbst entscheiden, wer er heute ist und wir sprechen uns jegliche Wechselseitigkeit ab, verlieren unsere gemeinsame Sprache, auf die unsere Republik beruht“. Dabei hob Kissler die Rolle der Medien hervor, um in einer gemeinsamen Sprache verständlich Informationen zu vermitteln.
Abschließend zitierte Kissler den langjährigen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der in seiner letzten Rede als Bundestagspräsident vor einem Zurückfallen in ein Stammesdenken gewarnt hat. Dies drohe, wenn wir uns einem identitätspolitischen Repräsentationsverständnis hingeben, welches auf dem Irrtum beruht, Repräsentation mit Repräsentativität gleichzusetzen.